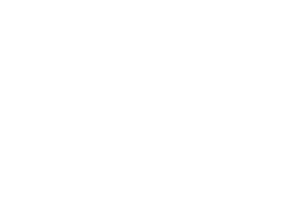Der Bundesverband Solarwirtschaft und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen stellen einen Leitfaden vor. Die Erzeugung von Solarstrom für Mieter und Wohnungseigentümergemeinschaften stoße auf großes Interesse, das Potenzial werde aber bislang kaum genutzt.
Mit dem im vergangenen Mai verabschiedeten „Solarpaket 1“ erfolgte auch die Einführung des Konzepts der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Das erste Projekt mit diesem in Paragraf 42b des Energiewirtschaftsgesetzes verankerten Instrument wurde allerdings erst im vergangenen Februar umgesetzt, nur wenige weitere sind seither gefolgt. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) unternehmen nun einen gemeinsamen Versuch, diese ernüchternde Bilanz zu verbessern. Die beiden Verbände haben am Dienstag den „Leitfaden Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ vorgestellt, der zum kostenlosen Download bereitsteht.
Eine von beiden Verbänden unter 350 GdW-Mitgliedsunternehmen durchgeführte Umfrage ergab, dass 44 Prozent Pläne beziehungsweise Projekte für den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf vermieteten Gebäuden verfolgen und weitere 38 Prozent grundsätzlich daran interessiert sind. Gleichzeitig ergab eine vom BSW-Solar beauftragte Umfrage des Meinungs- und Marktforschungsunternehmens Yougov unter rund 1000 Mieterinnen und Mietern, dass 53 Prozent der Befragten die Installation einer Photovoltaik-Aufdachanlage als Klimaschutzmaßnahme ihres Vermieters begrüßen würden. Damit liegt diese Option noch deutlich vor der Erlaubnis zur Anbringung von Photovoltaik-Balkonanlagen (36 Prozent) und dem Einbau einer klimafreundlichen Heizung (33 Prozent).
Von denjenigen Wohnungsunternehmen, die bereits Photovoltaik-Anlagen installiert haben, nutzen 51 Prozent indes die Option der Volleinspeisung, 46 Prozent verpachten Dachflächen an Dritte. Nur 33 Prozent haben bislang Mieterstrom-Konzepte umgesetzt. An der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung besteht aber großes Interesse: Auf die Frage, ob sie sich ein solches Konzept vorstellen könnten, antworteten unter denjenigen, denen dieses Instrument bereits bekannt ist, 17 Prozent mit „ja“ und 44 Prozent mit „eher ja“ („nein“: 11 Prozent; „eher nein“: 22 Prozent).
BSW-Solar und GdW sehen denn auch große Möglichkeiten für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, wie beide Verbände bei der Vorstellung ihres Leitfadens mitteilten. Bislang hätten Mieterinnen und Mieter „bestenfalls mittels kleiner ‚Balkonkraftwerke‘ oder Mieterstrom-Modellen, die sich meist nur in größeren Mehrfamilienhäusern wirtschaftlich darstellen lassen“ von der Solarstromerzeugung auf Mehrfamilienhäusern profitiert, mithin nur „in sehr begrenztem Umfang“. Das soll sich ändern: „Von Solaranlagen auf Mehrfamilienhäuser profitieren Mieter und Vermieter gleichermaßen“, so BSW-Solar-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Es gelte nun, das große Potenzial „mit Hilfe einer Gemeinschaftlichen solaren Gebäudeversorgung zu heben“.
„Solar- und Wohnungswirtschaft ziehen an einem Strang“, erklärte GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser. Gefragt sei aber auch der Gesetzgeber, der „vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Kundenanlage“ einen weiterhin verlässlichen Rahmen schaffen müsse, „der den Ausbau dezentraler Energieerzeugung und die Verteilung des erzeugten Stroms an lokale Kunden fördert, bestehende Kundenanlagen schützt und eine vereinfachte Regulierung kleiner Quartiersnetze ermöglicht“.
Der Leitfaden selbst illustriert indes, dass es auch mit der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nicht ganz trivial ist, ein Mehrfamilienhaus mit Solarstrom zu versorgen. Die 37 Seiten sind recht eng bedruckt, allein sechs Seiten nimmt ein Mustervertrag für die mit den einzelnen Gebäudestrom-Nutzern erforderliche Vereinbarung ein. Ebenso viel Platz benötigt die Beschreibung zur erforderlichen Messtechnik und zu den möglichen Aufteilungsschlüsseln – also zu den Punkten, die wegen ihrer Komplexität oftmals als problematisch für die praktische Umsetzung kritisiert werden.
Auch im Leitfaden selbst heißt es, derzeit bestünden „in der Branche noch Unklarheiten darüber, ob die nötigen Prozesse der Marktkommunikation für den Austausch der Daten zwischen Anlagenbetreiber, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und externem Stromversorger bereits ausreichend geregelt wurden, um das Modell massengeschäftstauglich umzusetzen“. Es sei deshalb eine Aktualisierung des Leitfadens geplant, sofern die Bundesnetzagentur hierzu weitere Festlegungen vornimmt. BSW und GdW wollten ihre Mitglieder über alle zukünftigen Entwicklungen rund um die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung auf dem Laufenden halten.